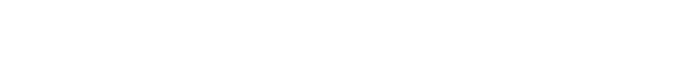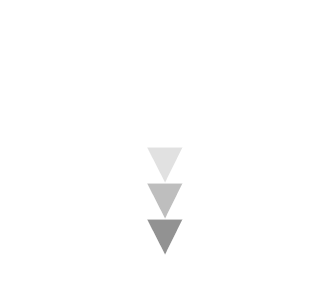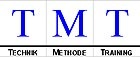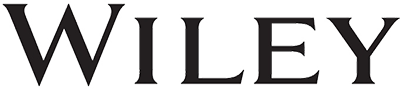Welchen Einfluss hat eine von den Vorgaben der DIN EN 1092-1 abweichende Dichtflächengüte
Seit dem Jahr 2002 beziehungsweise seit 2006 existiert die DIN EN 1092-1. In dieser Norm wird die Flanschgeometrie im Ganzen und die Oberflächengüte der Dichtleisten und der Dichtfläche z. B. eines Rücksprungs im Einzelnen beschrieben. Außer den Maßen werden auch die Toleranzen und die Rauheit der Oberflächen festgelegt.
Bei dem einen oder anderen Anwender taucht immer wieder die Frage auf, welche Auswirkungen auf die Dichteigenschaften der Verbindung eine Abweichung zum Gröberen oder zum Feineren hin haben könnte. Wegen der Grundsätzlichkeit dieser Fragestellung wird im Folgenden eine Antwort gegeben.
2) Stand der Normung in Bezug auf die Dichtflächengüte
Die in Rede stehenden Flansche werden in der Regel als Schmiedestück mit – notwendigerweise – gedrehten Dichtflächen gefertigt. Es wird also allein deshalb keine feinere Oberflächenstruktur der Dichtflächen als Standardausführung gefordert, weil wirtschaft-liche Gründe dagegen sprechen und nicht dichtungstechnische. In diesem Sinne ist auch der Vermerk zu der feineren Oberfläche nach Tabelle 2 der DIN EN 1092-1 »B2: Nur nach Vereinbarung zwischen Besteller und Flanschhersteller« zu interpretieren.
2.1 Nach der Norm DIN 2526 "Flansche – Formen der Dichtflächen" waren Dichtleis-ten der Form C, der Form D und der Form E mit abnehmenden maximal erlaubten Rau-tiefen möglich.
Form C 40 ≤ RZ ≤ 160 µm gedreht Für Nenndruckstufe PN 1 bis PN 40
Form D RZ = 40 µm gedreht Für Flansche Nut/Feder – Vor/Rücksprung
Form E RZ = 16 µm gedreht Für Nenndruckstufe PN 40 bis PN 400
2.2 Nach der nunmehr gültigen DIN EN 1092-1 "Flansche und ihre Verbindungen – Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile nach PN bezeich-net – Teil 1: Stahlflansche" entspricht der Dichtflächenform C und D die Bezeichnung B1 und der Dichtflächenform E die Bezeichnung B2. Es fällt ins Auge, dass sich die neuen Dichtflächenformen B1 und B2 durch wesentlich niedrigere maximal zulässige Rautiefen von den nach DIN 2526 vorgeschriebenen unterscheiden.
Form B1 12,5 ≤ RZ ≤ 50 µm gedreht Standard für alle Nenndruckstufen
Form B2 3,2 ≤ RZ ≤ 12,5 µm gedreht Nur nach Vereinbarung
2.3 Zum einen kann man aus den vorgenommenen Veränderungen in der Beurteilung der Dichtflächenqualität durch die Einführung der DIN EN 1092-1 ersehen, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass Dichtflächen mit geringeren Rauheiten eine qualitative Verbesserung darstellen. Statt der im Mittel bei 80 µm liegenden Rauheit der DIN-Flansche Form C und der mit 16 µm angestrebten Rauheit der Form E werden nunmehr standardmäßig bei DIN EN 1092-1 im Mittel 25 µm für Form B1 gefordert. Auf Kundenwunsch kann für die Form B2 eine reduzierte Rauheit von RZ = 3,2 µm bis maximal RZ = 12,5 µm vereinbart werden.
3) Die Abweichungen
Es handelt sich also um Flansche, deren Geometrie nach DIN EN 1092-1 ausgeführt wird. Die zu beurteilende Abweichung von der DIN EN 1092-1 betrifft allein die Oberflächengüte der Dichtleisten.
3.1 Wenn die Abweichung größere Rauheiten als nach Norm bedeutet
Bis spätestens 2002 (als die DIN EN 1092-1 in Kraft trat) wurde in den bis dahin gültigen DIN-Normen (z. B. DIN 2526) die Meinung vertreten, dass grob gedrehte Flanschdichtflächen Dichtungen aus Faserstoffen gegen Herausdrücken durch den Innendruck schützen könnten. Aus der Zeit bis 2002 stammt auch die Forderung nach rauen Flanschdichtflächen der Form C nach DIN 2526 mit durchschnittlich RZ = 90 µm. Nur so ist auch der Hinweis zu Dichtflächenform C zu verstehen: »Nicht feiner als 40 µm«.
Heute ist unstrittig, dass in Abhängigkeit von der "Härte" der Dichtungsoberfläche und der Rauheit der Flanschdichtfläche eine Mindestflächenpressung zur Erzielung einer gewissen Leckagerate erforderlich ist. Je härter die Dichtung um so feiner sollte die Flanschdichtfläche sein, um die Anpassung der beiden am Dichtvorgang beteiligten Flächen zu erleichtern. In diesem Zusammenhang soll von inneren Leckagewegen abgesehen werden.
Der Autor empfiehlt in "Die Optimierung statischer Dichtungen" für die maximale Rau-heit der Flanschdichtflächen für Metalldichtungen folgende Werte in µm
Blei: RZ = 100 Kupfer: RZ = 6,3 Nickel: RZ = 3,2
Gold: RZ = 25 Messing: RZ = 6,3 Stahl: RZ = 3,2
Aluminium: RZ = 25 Eisen: RZ = 3,2 Titan: RZ = 3,2
Silber: RZ = 12,5 Monel: RZ = 3,2 Edelstahl: RZ = 1,6
Harte Metalldichtungen werden deshalb auch mit Überzügen aus weicheren Metallen, zum Beispiel Silber, versehen.
3.2 Wenn die Abweichung kleinere Rauheiten als nach Norm bedeutet
Die angesprochene kleinere Rauheit kann z. B. dadurch zustande kommen, dass die Flanschdichtfläche nicht durch spangebende Verfahren hergestellt wird, sondern dass ein im Bereich der Dichtfläche unbearbeitetes Präzisionsblech aus zum Beispiel Hastelloy mit einer maximalen Rautiefe von RZ = 1 µm Verwendung findet.
Es sind dann prinzipiell zwei Fälle möglich:
1.) Es werden zwei modifizierte Dichtflächen aus Hastelloy mit dazwischen angeordneter Dichtung miteinander verbunden und
2.) Es wird eine modifizierte Dichtfläche aus Hastelloy mit einer gedrehten Standard-Dichtfläche verbunden.
Der zweite Fall ist im Rahmen dieser Untersuchung ohne Bedeutung, da die Dichtung auf der Flanschdichtfläche mit der standardisierten Rauheit keine Änderung erfährt.
Im ersten Fall ist deshalb in Punkt 4 zu überprüfen, ob die Leckagerate beeinflusst wird und im Punkt 5 ist zu schauen, welchen Einfluss eine feinere Oberfläche auf die Sicherheit der Verbindung hat.
4) Stand der Normung in Bezug auf die Qualität der Abdichtung
Die Prüfnorm DIN EN 13555:2004 "Flansche und ihre Verbindungen – Dichtungskennwerte und Prüfverfahren für die Anwendung der Regeln für die Auslegung von Flanschverbindungen mit runden Flanschen und Dichtungen" fordert für die Oberflächenbeschaffenheit der Prüfplatten eine Rauheit von 3,2 µm < Ra < 6,3 µm, was einer Rauheit von 12,5 µm < RZ < 50 µm entspricht. Diese Rauheit wurde gewählt, damit die Ergebnisse auf Standardflansche mit der Dichtleiste Form B1 mit ebenfalls Rauheiten von 12,5 µm < RZ < 50 µm anwendbar sind.
4.1 Der Dichtungskennwert Qmin (L) wird mittels dieser Prüfplatten gemessen und bezeichnet die (Zitat) »Mindest-Flächenpressung auf der Dichtung bei Montage bei Raumtemperatur, damit durch Anpassung der Dichtung an die Rauheit der Flanschdichtflächen und Abdichten der inneren Leckagewege die geforderte Dichtheitsklasse L für den gegebenen Innendruck erreicht wird.«
4.2 Es ist offensichtlich, dass die Anpassung der Dichtungsoberflächen an die Rauheit der Flanschdichtflächen bei grob gedrehten Dichtflächen schwierig ist. Sie erfolgt um so leichter, um so weniger stark die Rauheit der Flanschdichtflächen ausgeprägt ist. Mit anderen Worten: Wenn die Rauheit außerordentlich niedrig ist, wird schon mit kleinen Werten Qmin (L) die gewünschte Dichtheit erreicht. Diese hängt dann bei porösen Dich-tungswerkstoffen überwiegend nur noch von den oben erwähnten »inneren Leckagewegen« ab
Wie man aus obigem ersehen kann, führt demnach der Einsatz von Flanschdichtflächen mit geringerer Rautiefe als nach der DIN EN 1092 vorgeschrieben ist zu verbesserten Abdichteigenschaften. Aus diesem Grund ermöglicht auch die Norm durch die Dichtflächenform B2 für bestimmte kritische Anwendungen eine Oberfläche mit reduzierter Rauheit.
5) Stand der Normung in Bezug auf die Sicherheit der Verbindung
Nun ist noch ein letzter Aspekt zu untersuchen und zwar die Sicherheit der Flanschver-bindung gegen Ausblasen oder spontanes Bersten der Dichtung im Betriebszustand.
5.1 Bis spätestens 2002 (als die DIN EN 1092-1 in Kraft trat) wurde in den bis dahin gültigen DIN-Normen (z. B. DIN 2526) die Meinung vertreten, dass grob gedrehte Flanschdichtflächen Dichtungen aus Faserstoffen gegen Herausdrücken durch den In-nendruck schützen könnten. Aus der Zeit bis 2002 stammt auch die Forderung nach rauen Flanschdichtflächen der Form C nach DIN 2526 mit durchschnittlich RZ = 90 µm. Nur so ist auch der Hinweis zu Dichtflächenform C zu verstehen: »Nicht feiner als 40 µm«.
5.2 Die DIN V ENV 1591-2 "Flansche und ihre Verbindungen – Regeln für die Auslegung von Flanschverbindungen mit runden Flanschen und Dichtung. Teil 2: Dichtungskennwerte" listet Werte QI/P von 1,3 bis 2,0 auf (wenn man von Werten für Gummi mit 0,9 als Ausnahme absieht). Damit wird sichergestellt, dass auf der Dichtung in allen Betriebszuständen eine um diesen Faktor über dem abzudichtenden Innendruck liegende Flächenpressung verbleibt und somit ein Ausblasen mit Sicherheit vermieden wird. Da die Norm DIN EN 1591-1 alle hindernden Einflüsse erfasst, trifft das auch zu.
Der Entwurf DIN EN 1591-2:2006 sagt für Flachdichtungen aus Weichstoffen und Metall/Weichstoffen aus, dass im Betriebszustand eine von der geforderten Leckagerate abhängige Mindestflächenpressung Qs,min(L) vorhanden sein muss. Damit wird der empirische Quotient QI/P nun durch einen leckagebezogenen Messwert ergänzt beziehungsweise ersetzt.
5.3 In jedem Fall, sowohl nach der Vornorm ENV 1591-2:2001 als auch nach dem Ent-wurf DIN EN 1591-2:2006, ist somit durch eine ausreichend hohe Restpressung im Betriebszustand dafür gesorgt, dass Bersten der Dichtung ausgeschlossen wird.
Ausblasen oder Bersten wurde immer nur dann beobachtet, wenn im Betriebszustand die mindestens erforderliche Flächenpressung unterschritten wurde.
Dies ist unabhängig von der Dichtflächengüte, sie spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Auch die Festigkeit des Dichtungswerkstoffs spielt unter dem Gesichtspunkt der Berstsicherheit keine Rolle, sonst könnt man zum Beispiel keine Dichtungen aus expandier-tem Graphit mit einer bekanntlich äußerst geringen Zugfestigkeit einsetzen.
6) Zusammenfassung
Die Kommentare zu Punkt 3 und Punkt 4 haben gezeigt, dass eine bessere Oberflächengüte als von der Norm mindestens gefordert ein verbessertes Dichtverhalten ergibt.
Der Kommentar zu Punkt 5 hat gezeigt, dass eine bessere Oberflächengüte andererseits keine Nachteile im Sicherheitsverhalten mit sich bringt.
Flanschdichtflächen mit besserer als der Norm entsprechender Oberflächengüte werden nur deshalb nicht explizit gefordert, weil damit unnötige Kostensteigerungen einhergehen würden.
Alles spricht gegen den Einsatz von Flanschen mit Dichtflächen, die eine schlechtere, rauere Oberflächengüte aufweisen als die Norm mindestens fordert.
Nichts spricht aber gegen den Einsatz von Flanschen mit Dichtflächen, die eine bessere Oberflächengüte aufweisen als die Norm fordert. Eine Verbesserung der Oberflächengüte führt zu einer Verbesserung der Abdichteigenschaften der Flanschverbindung ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.
ist aus unserem Archiv!
Aktuelle Produkte finden Sie über die Suche ...